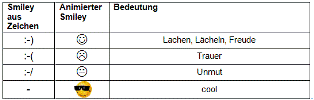E-Journal "w.e.b.Square: Wissensmanagement und E-Learning unter Bildungsperspektive"
Ausgabe: 2010 01
El Tahwy, R., Möller, E. & Serger, F. (2010). GOETHE GOES WEB 2.0. *rofl*, HDGDL - Wie sich die Sprache im Internet verändert. w.e.b.Square, 01/2010. URL: http://websquare.imb-uni-augsburg.de/2010-01/5.
GOETHE GOES WEB 2.0
*rofl*, HDGDL - Wie sich die Sprache im Internet verändert
„Wikifizieren, Geupspeeded, Yiggen“. Die Kreativität der Online-Community im Umgang mit Sprache ist scheinbar grenzenlos, schließlich entwickelt sich die Sprache gefühlt mindestens genauso schnell wie das Internet selbst. Die Frage ist: Um welchen Preis? Es rumort in Deutschland. . Akademiker und Journalisten machen sich Sorgen um die Zukunft der deutschen Sprache in Zeiten des World Wide Web. w.e.b.Square gibt Einblick, Überblick und Vorausblick hinsichtlich der Internetsprache und geht zusammen mit Goethe auf Spurensuche...
„Ein jeder, weil er spricht, glaubt, auch über die Sprache sprechen zu können.“ (Goethe, 1856, S. 370) Goethe. Johan Wolfgang von. Ein Leuchtturm der deutschen Kultur, Hüter der deutschen Sprache, „Mastermind“ der ohnehin schon glorreichen hiesigen Schreibkultur. Und Vordenker, wenn nicht sogar Hellseher, denn sein Zitat könnte aktueller nicht sein. Es wird dieser Tage viel über die Sprache gesprochen und es steht nicht gut um deren Zustand: Die deutsche Sprache steht vor dem Abgrund! Nein, hier spricht kein notorischer Kulturpessimist, sondern die schwarz-gelbe-Koalition, zumindest zwischen den Zeilen. „Die Sprache der Bundesrepublik ist deutsch“, so soll es bald im Grundgesetz stehen. Vordergründig geht es um den negativen Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache. Überträgt man diese Forderung auf das Internet, dann wird fraglich, ob diese realistisch ist, gerade angesichts des dort vorherrschenden Anglizismen-Narzissmus: „Download mal das Proggi zum Foten, das funzt!“ (Lischka, 2007) - Goethe würde sich in seinem Grabe wälzen, wäre er online.
Die „neue“ Sprache
Die deutsche Sprache unterliegt einem stetigen Wandel. Zu dieser These kommt man, auch ohne Sprach- oder Literaturwissenschaftler zu sein. Denn diese These ist einleuchtend. Man erinnere sich nur einmal an seine Schulzeit zurück, in der man versuchen sollte, Worte aus Goethes Faust (1996, S. 24) zu entschlüsseln. „Verzeiht! ich hör Euch deklamieren / Ihr last gewiss ein griechisch Trauerspiel? / In dieser Kunst möcht ich was profitieren, / denn heutzutage wirkt das viel.“
Sprachliche Eigenheiten hat jede Epoche und innerhalb der Epochen gibt es Eigenheiten innerhalb der einzelnen Gesellschaftsgruppen.
Doch das letzte Jahrzehnt verursachte etwas Merkwürdiges, etwas Außergewöhnliches. Eine neue Art der Sprache, die nicht mehr eindeutig einzuordnen ist. Mit „Internetsprache“ (Runkehl, Schlobinski & Siever, 1998, S. 209), „Websprache“ oder „Netzsprache“ wird diese Form der Kommunikation gerne betitelt. Kaum einer weiß wirklich, wie sie zu definieren ist. Denn das Internet an sich ist sehr vielfältig.
Der ursprüngliche Zweck des Internets, E-Mails zu versenden, entwickelte sich zum „Web 2.0“, einem „Mitmachmedium“ (Panke, 2007, S. 2). Jeder kann schreiben – oder posten, wie es im Internetjargon heißt - und so kommunizieren. Ob in Chats, E-Mails, Foren oder Gästebüchern - die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Damit gehen auch die Probleme der einheitlichen Definition einher.
Eine Sache der Definition
War zu Goethes Zeiten noch eindeutig geklärt, ob etwas gesprochene Sprache oder Schriftsprache ist, wird es da heute schon schwieriger. Gilt ein Chat, in dem zwei Menschen zeitgleich dialogisch miteinander kommunizieren nun als Gespräch oder als Schriftverkehr? Sie schreiben, das scheint klar zu sein, aber die Sprache, die sie verwenden, ähnelt mehr dem gesprochenen Wort. Die Sprache im Internet ist nicht nur durch solche Schwierigkeiten schwer zu fassen. Die eine Internetsprache kann nicht definiert werden, darin sind sich die Wissenschaftler einig (vgl. z. B. Runkehl et al., 1998). Es muss zwischen den Formen der Kommunikation, also der Art des verwendeten Dienstes, differenziert werden.
Der Beziehungseisberg
Wird durch diese neue Sprechweise die Kommunikation beeinflusst?
Hierfür sollte zunächst geklärt werden, was Kommunikation überhaupt bedeutet. Kommunikation kommt vom lateinischen communicatio, was laut Duden so viel bedeutet wie „Mitteilung, Unterredung“. Die erste Ebene (Mitteilung) meint Kommunikation als einseitigen Prozess, als Mittel der Übertragung von Information. Unter Unterredung hingegen versteht man einen zweiseitigen Prozess der symbolischen Bedeutungskonstruktion, meist in Form eines Gesprächs (Bonfadelli, 2005). Hier sind Austausch, Teilhabe und Verständigung zentrale Eigenschaften der Kommunikation. Der Kommunikationswissenschaftler Watzlawick (2000) hat in seinem „Eisbergmodell“ beschrieben, dass lediglich 1/7 der Kommunikation auf der Inhaltsebene stattfindet und 6/7 auf der Beziehungsebene. Im Gegensatz zur Inhaltsebene, wo die Kommunikation auf eindeutigen Symbolen, Zeichen und Wörtern basiert, wird auf der Beziehungsebene, auch Metakommunikation genannt, nonverbal und meist unbewusst mit Gestik und Mimik kommuniziert (vgl. Hoffmann et al., 2004, S.31 f.). Darunter fallen auch Gefühle und Einstellungen. Doch wie soll man im Internet, wo man Gestik und Mimik des Kommunikationspartners nicht sieht, Gefühle vermitteln?
Emoticons – Lasst euren Emotionen freien Lauf!
Gefühle spielen bei persönlicher und informeller1 Kommunikation eine große Rolle.
Bereits Schiller beschrieb in einem Brief an Goethe seine Emotionen mit den Worten „Mit wahrer Herzenslust habe ich das erste Buch Wilhelm Meisters durchlesen, und verschlungen, und ich danke demselben einen Genuß, wie ich lange nicht, und nie als durch
Sie gehabt habe. Es könnte mich ordentlich verdrießen,“ (Unbekannt, 1856, S.35/f).
Für solch eine bedachte Wortwahl und Umschreibung der Gefühle bleibt in der Schnelllebigkeit des Internets keine Zeit.
Doch trotz dieses Zeitmangels möchte sich der Internetnutzer auch persönlich mitteilen. In einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht müssen Emotionen nicht in Worte gefasst werden, denn sie spiegeln sich auf unserem Antlitz. Im Internet entfällt diese Komponente.
Eine Lösung dieses Problems stellen Smileys dar, sogenannte Emoticons. Sie vertreten uns und unseren Gesichtsausdruck im Internet, z. B. in einer Chatrunde. Anfangs aus einfachen Satzzeichen zusammengesetzt, bieten die meisten Dienste heutzutage animierte Smileys an. Dem Einfallsreichtum scheinen hier keine Grenzen gesetzt zu sein: Vom einfachen Lachen und Zwinkern zum Umarmen, Weinen, rot vor Wut Anlaufen oder gar übertriebene Smileys, die sich selbst mit einem Hammer schlagen – es gibt fast nichts, was es nicht gibt.
Smileys- eine kleine Auswahl
Wirth (2005) schreibt den Smileys neben den Emotionen eine weitere Bedeutung zu. Er sieht in ihnen mehr als eine bloße Verbildlichung der durch Schrift transportierten Gefühle. Ihm zufolge kommentieren sich die Benutzer durch Smileys selbst und weisen explizit und gewollt auf ihre Einstellung hin.
Dies macht einen Unterschied zur Körpersprache aus, durch die wir meist unbewusst Signale über unseren Zustand preisgeben und die sehr schwer zu steuern ist.
*rofl*, *lol*, *grins* - kurz: Inflektive
Völlig bewusst dagegen werden Inflektive im Internet eingesetzt. Mit rhetorischen Besonderheiten wie *grins*, *lol* oder *rofl* hätte das Sprachgenie Goethe vermutlich so seine Probleme gehabt. Was genau ist damit gemeint? Die Bedeutung herzuleiten mag sich als schwierig bis gar unmöglich erweisen, wenn man sie nicht kennt.
Inflektive stellen, so Androutsopoulos (2003), eine Handlungs- und Zustandsbeschreibung dar. Gekoppelt sind sie meist mit Abkürzungen (Akronymen) und Anglizismen. Das Beispiel *lol* (laughing out loud) soll lautes Lachen ausdrücken. Auch *rofl* (rolling on the floor laughing) kommt aus dem Englischen und beinhaltet ein Akronym. Ein wichtiger Hinweis auf solche Inflektive sind die Sternchen, die ankündigen, dass eine Handlung folgt. So kann man eigentlich jeden momentanen Gemütszustand oder jede virtuelle Aktion andeuten. Dies geht von *grins* und *freu* über *knuddel* (Schlobinski, 2001) zu *Tartagura kriecht durch den Raum und begrüßt mal alle Anwesenden* (Wirth, 2005, S. 82).
Inflektive können somit als kreativer Umgang mit den Einschränkungen des Mediums verstanden werden und „kompensieren das Fehlen der para- und nonverbalen Ebene“ (Beißwenger, 2000, zitiert nach Androutsopoulos 2003, S.187). Eine virtuelle Interaktion mit dem Kommunikationspartner, die über die reine verbale Kommunikation hinaus geht, wird ermöglicht.
Von Graphemen, Akronymen, Ellipsen und Anglizismen oder: „Have u lieb“
Für die informelle Kommunikation im Internet bildete sich eine Vorherrschaft von bestimmten rhetorischen Stilmitteln heraus.
Grapheme oder, wie Tuor (2009) beschreibt, Graphem-Phonem-Kombinationen, spielen mit der Aussprache von Wörtern. Die orthografische Richtigkeit leidet hier zugunsten einer verkürzten Form. Im Englischen wird meist der Gleichklang von einzelnen Buchstaben mit Wörtern ausgenutzt, Beispiele sind „u“ für „you“ oder „c“ für „see“, woraus sich der berühmte Abschiedsgruß „cu“ zusammensetzt.
Im Deutschen werden Zahlen anstelle von Buchstaben gesetzt (beispielsweise: „Gute N8!“) oder die Schreibweise wird zugunsten der klanglichen Ähnlichkeit völlig verändert, wie bei „häppi börsdei“ (Tuor, 2009, S. 104).
Durch die Iteration, die Wiederholung von Buchstaben, können technisch bedingte Defizite ausgeglichen werden, indem die Sprechweise schriftlich nachgeahmt wird. Das Singen ist hier eine äußerst offensichtliche Form wie das Ausschreiben des Geburtstagslieds „Happy Birthday“ beweist: „HAPPY BIRTHDAY TO YOUUU! HAPPY BIRTHDAY TO YOUUUUUUUU
HAPPY BIRTHDAY. DEAR [...]! HAPPY BIRTHDAY TOOOOOOO YOUUUUUUUUUUU!” (ebd., S. 105).
In den oben genannten Beispielen wird auch der Einfluss des Englischen auf die Sprache im Internet sichtbar. Es entsteht ein Mix aus Deutsch und Englisch. Hierbei etablierten sich bereits Standardfloskeln wie „cu“ oder das bereits erwähnte „lol“. Teilweise dürften sich die Anwender gerade bei Akronymen aber nicht unbedingt über den wortwörtlichen Gehalt der Abkürzung, sondern nur ihrer übertragenen Bedeutung im Klaren sein. Hierbei stellt sich unweigerlich die Frage, wo der digitale Buchstabengeiz herrührt.
SMS als Verursacher der Schreibfaulheit?
Radikale Abkürzungen werden außerhalb des Internets auf dem Handy verwendet. Denn hier greift das, was so manchem noch aus dem Zeitalter der Telegraphie ein Begriff ist: Platzmangel. Statt eines Telegramms schickt man heutzutage eine SMS. Eine Standard-SMS hat Platz für genau 160 Zeichen. Nicht mehr. Um Kosten für eine weitere SMS zu sparen, erfreuen sich Abkürzungen, insbesondere unter Jugendlichen, großer Beliebtheit etabliert, bei denen sich möglichst viele Zeichen einsparen lassen. Hunderte Ratgeber finden sich über diese besonderen Abkürzungen. „Bidunowa?“ braucht nur die Hälfte der 18 Zeichen von „Bist du noch wach?“. Man könnte nun vermuten, dass sich die Zeicheneinsparung aus Kostengründen auf die Online-Welt übertragen hat. Denn auch Statusmeldungen im Internet sind in der Zeichenzahl fast immer beschränkt. Der neue Star am Internethimmel „Twitter“ beschränkt die Länge der Meldungen auf 140 Zeichen.
Siever (2009) meint dazu jedoch, dass auch in SMS, in denen - ebenso wie in Internetnachrichten - der zur Verfügung stehende Platz nicht annähernd ausgenutzt wird, Akronyme zum Einsatz kommen. Die „Tippökonomie“ sei vielmehr darauf zurückzuführen, dass schnell geschrieben werden soll.
Es gibt außerdem auch weitere Abkürzungen, die speziell im Internet entstanden sind. „afk - away from keyboard“. Die SMS kann also nicht zwangsläufig als Verursacher der Verwendung von Abkürzungen und seltsamen Satzgefügen angeprangert werden.
Chatter haben keine Zeit
Denn vor allem „Chat-Schreiber stehen unter Zeitdruck und müssen möglichst ökonomisch tippen“ (Storrer, zitiert nach dpa, 2009). Dies fördert die durchgehende Kleinschreibung des Deutschen, da einem somit das Drücken der Shift-Taste erspart bleibt. Auch Auslassungen, sogenannte Ellipsen, ergeben sich aus der Anforderung, dem Chat-Partner in möglichst kurzer Zeit zu antworten. Ein weiterer Grund für das Einsetzen von Ellipsen ist die am mündlichen Sprachgebrauch orientierte Schreibweise. Hierbei entfällt oft das Pronomen wie bei „hab dich lieb“ statt „Ich habe dich lieb“.
Die Einsparung von Zeichen kann durch Akronyme noch weiter erleichtert werden. So wird aus „hab dich lieb“ „HDL“. Um eine reibungslose Verständigung zu ermöglichen ist jedoch das Hintergrundwissen des Kommunikationspartners zu beachten, da nicht alle Abkürzungen für sich selbst sprechen.
Pinnwände – die modernen Gästebücher
Doch es wird nicht nur gechattet im Web 2.0. Eine fast vergessene Tradition erlebt hier ein wahres „Revival“. Gästebücher, Relikte aus alten Zeiten, in denen Reisende ihre Meinung kundtaten, sind heute aktueller denn je. Die meisten sozialen Netzwerke im Internet bieten einem sogar ein persönliches an: Pinnwände auf StudiVZ, die Profilwand bei Facebook oder Gästebücher bei MySpace oder Lokalisten. Die wiederbelebte alte Textsorte (Diekmannshenke, 1999) funktioniert wie ihr Vorgänger auf Papier. Jeder, dem es gestattet ist (damals beispielsweise den Gästen eines Wirtshauses, heute Freunden in sozialen Netzwerken) kann eine kurze Nachricht hinterlassen. Bezogen sich diese damals womöglich auf den Komfort der Betten oder die Qualität der Speisen, werden heutzutage Grüße und Wünsche geäußert und der Kontakt gepflegt (vgl. Tuor, 2009, S. 81).
Nach Tuor (2009) werden diese Nachrichten meist informell verfasst und beinhalten die für das Internet allgemeinhin typischen Merkmale: Akronyme, gesprochene Sprache, Inflektive und Emoticons.
Die Einträge in den Gästebüchern sind daher der konzeptionellen Mündlichkeit zuzuordnen: Sie sind spontan und in gesprochener Sprache verfasst (vgl. Tuor, 2009, S. 97).
Interessant ist hierbei, dass diese Kommunikation teilweise so gestaltet ist, dass nur der Adressat die Nachricht „entschlüsseln“ und verstehen kann. Eine noch weit spontanere und lebhaftere Dokumentation ist allerdings im Chat zu finden.
Chats - schriftliche Gespräche?!
Der Chat stellt ein Hauptproblem in den Definitionsversuchen zur Internetsprache dar. Denn die Art im Chat zu kommunizieren ist relativ neu und nicht anzulehnen an tradierte Kommunikationswege. Daher gibt es bis dato in der Literatur sehr wenig Einheit und noch erheblichen Klärungsbedarf.
Es existieren öffentliche und private Chats sowie Chats, in denen viele kommunizieren oder Chats mit nur zwei Kommunikationspartnern. Welche Form man auch wählt, der Chat läuft nach bestimmten Grundregeln ab: Jeder kann jederzeit Nachrichten schreiben. War Goethe wohl noch bedacht darauf, seine Gesprächspartner ausreden zu lassen, da das Gespräch sonst vermutlich gescheitert wäre, scheint diese Beschränkung im Internet aufgehoben. In einer Konversation können mehrere Kommunikationsstränge nebeneinander existieren, ohne dabei die anderen einzuschränken. Genauso gut ist es möglich, dass ein Kommunikator mit mehreren Partnern gleichzeitig kommuniziert. Oft bemerken die Gesprächspartner das noch nicht einmal. Der Chat verwirrt aber nicht nur durch die Aufhebung der Grundregeln eines funktionierenden Gesprächs.
Schreiben oder Sprechen? Das ist hier die Frage!
Die „Verschriftlichung der Sprache“ (Sandbothe, 1997 zitiert nach Wirth, 2005, S.68) lässt den Chat zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit schweben.
Die zeitliche und räumliche Komponente spielt bei diesem Problem eine erhebliche Rolle.
Tuor (2009) stuft den Chat als quasi-synchrone Art zu kommunizieren ein. Dies bedeutet, dass zwar eine gewisse zeitliche Abhängigkeit der Chat-Partner besteht, aber kleine zeitliche Pausen oder Verzögerungen möglich sind (wenn einer der beiden beispielsweise die Toilette aufsucht). Zudem zeichnet sich der Chat dadurch aus, dass sich die Gesprächspartner nicht unterbrechen, sondern nur miteinander interagieren können.
Räumlich wird von „ferner Anwesenheit“ (Wirth, 2005, S. 78) gesprochen, was impliziert, dass die Benutzer eines Chats zwar mental im Chatraum gemeinsam anwesend sind, sich jedoch physisch an einem andern Ort befinden.
Der Chat steht also begrifflich zwischen Telefongespräch, Massenkommunikation (öffentliche Chats) und E-Mail. Er ist schwer fest zu machen und windet sich aus jeglichem Definitionskorsett. Dass Chatten jedoch zu den neuen und innovativsten Formen der Kommunikation zählt, steht fest.
Der Mythos Websprache
Wie viele Merkmale der Websprache – wie auch immer sie nun definiert sein mögen - Goethe heutzutage verwenden würde, bleibt ein Rätsel. Gewiss ist jedoch, dass er sie sich nicht zwangsläufig aneignen müsste - was ihn sicher erfreuen würde. Die Sprachvariation im Netz ist nämlich abhängig vom genutzten Dienst (Chat, Forum, E-Mail etc.). Der soziale Kontext des Internetdienstes hat darüber hinaus einen noch größeren Einfluss darauf, ob und welche Emoticons, Akronyme und andere Sprachstile verwendet werden,. Die Websprache ist eng an die Ziel- und Hauptnutzergruppe des virtuellen Sprachraumes gebunden (Androutsopoulos, 2003). So findet man die Extreme der oben genannten Merkmale zumeist bei Jugendlichen, während in Seniorenchats und -foren deutlich weniger bis kaum Gebrauch davon gemacht wird. Insbesondere die wechselnde Groß- und Kleinschreibung innerhalb eines Wortes (z. B. HoMeBoyZ) weist auf eine eigene „Internetkultur“ hin. Anhänger des Hip-Hops verwenden in Internetdiensten speziell zu diesem Interessenbereich besonders häufig diese Schreibweise. Gekoppelt mit den Trendwörtern der Szene (v. a. Anglizismen) ergibt sich so ein gruppenspezifischer Stil - eine ganz eigene Hip-Hop-Websprache. Auch andere Fans bilden in ihren eigenen Communities eigene Stile aus. Im Fall der „Trekkies“ (Star Trek Anhänger) hat sich sogar eine vollständig imaginäre Sprache, klingonisch, entwickelt (Androutsopoulos, 2003).
Regionalchats als Freiraum für Mundart
Die Verschriftlichung der gesprochenen Sprache bringt zwangsläufig auch die Verschriftlichung von Dialekten mit sich. Deshalb treten in regionalbezogenen Chats die ortstypischen Dialekte geballt auf. Diese Häufigkeit wurde vor allem in Citychats untersucht. In Norddeutschland kommt Mundart jedoch deutlich seltener vor als in Süddeutschland oder gar in der Schweiz.
Bei Chats von Politikern mit den Bürgern nehmen diese nur selten Züge des „Cyberslangs“ an. Wenn, dann nur in abgespeckter Form. In einer arbeitsbezogenen Internetplattform werden die wenigsten Arbeitnehmer und -geber Emoticons oder gar Akronyme einsetzen. Die Nutzungsmotivation und Beziehung der Gesprächspartner sind in diesen Fällen die entscheidenden Faktoren für die (Nicht-)Verwendung bestimmter Möglichkeiten der Online-Dienste.
Goethe in der E-Mail-Mühle
Postkarten oder Briefe bekommen wir heutzutage fast nur noch mit Werbeinhalt oder als Rechnung. Einen echten handgeschriebenen Brief von einem geliebten Menschen erhalten die wenigsten. Der Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller füllt ganze Bände. Würden die beiden heutzutage leben, so würde man vermutlich eBooks mit den gesammelten E-Mails zusammenstellen. „Auf einem beyliegenden Blatte finden Sie die Veränderungen, die ich versucht habe, und es soll ganz von Ihnen abhängen, ob Sie solche genehmigen, das Alte beybehalten, oder etwas eigenes, Ihrer Überzeugung gemäßes, einschalten wollen.“ schrieb Goethe 1797 unter anderem an Wilhelm von Humboldt (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2006). „Meine Änderungen findest du im Anhang. Bitte bestätigen oder abändern.“ lautet der salbungsvolle Satz Goethes im E-Mail-Zeitalter.
Eigenheiten bei E-Mails
Im E-Mail-Verkehr haben sich ebenso wie in Chats und Foren längst Eigenheiten entwickelt. Die Rezeption des Geschriebenen ist am Bildschirm flüchtiger und somit ist die elektronische Post oftmals voll von Rechtschreibfehlern (Dürscheid, 2005). Zudem wird bei E-Mails zunehmend das sogenannte Quoting verwendet. Die Mail wird mittels des Antworten-Buttons automatisch kopiert. Unter die Fragen werden nun die Antworten eingefügt.
>Hallo Jürgen,
Hi,
>Was hältst du von Mittagessen um 15 Uhr?
Geht klar!
>Kannst du mir dann vielleicht die Unterlagen für Geschichte mitbringen?
Brauch ich leider selber noch.
>
>Bis dann
Hol dich ab.
>
>Paul
Quoting als verkümmerte Antwort?
In dieser verkümmerten Form der Antwort wird das „Gespräch“ wie im normalen Sprachgebrauch fortgeführt. Der „Verlauf“ der gesamten E-Mail ist nun nahezu gleich zu lesen wie ein Chat. Schmitz (Schmitz zitiert nach Dürscheid, 2005) geht davon aus, dass die Verwendung der sprachlichen Mittel stark von Faktoren wie Vertrautheit, Thema und Lebensbereich abhängen. Die Vertrautheit spiegelte sich früher schon in der Begrüßung wieder, doch diese Anreden werden mit den E-Mails zunehmend personalisierter. So erlangen „Hallo“ und „Guten Tag“ zusehends an Beliebtheit - auch bei Personen, die man beim Face-to-Face (also dem persönlichen) Kontakt siezen würde.
Auswirkungen auf den „normalen“ Schreibstil
Wie wirkt sich nun die Kommunikation mit E-Mails auf den persönlichen Schreibstil, z.B. beim Verfassen von Briefen, aus? Grzega (1990) stellte in seiner Untersuchung nur wenige Veränderungen fest. Von 32 befragten Personen gaben nur sechs an, ihr Schreibstil habe sich durch E-Mails verändert. Allerdings ist zu bedenken, dass es sich hier um eine subjektive Selbsteinschätzung handelt. Um diese Problematik zu umgehen, hat Grzega deshalb mit drei Personen eine Längsschnittstudie zu diesem Thema durchgeführt. Das Ergebnis der Untersuchung zeigte keine signifikanten Veränderungen im Schreibstil der Probanden (ebd.).
Vom Mittelalter über Luther bis heute – Sprache im Wandel
Diese Ansicht ist nicht überraschend, schaut man einmal auf die Geschichte der deutschen Sprache. Sprache hat sich schon immer verändert und weiterentwickelt. Zwar verlangsamt die Verschriftlichung von Sprache diesen Prozess, stilllegen kann sie ihn aber nicht2. Der Sprachwissenschaftler Guy Deutscher (2005, S. 60f.) zeigt an einem Bibelbeispiel, wie sich die deutsche Sprache über Jahrhunderte entwickelt hat:
Aus dem Matthäusevangelium:
Deutsch um 1315 (Mentelbibel):
„Und do ihesus was genachent zu jherusalem und waz kumen zu Bethphage an den berg den olbaum: do sandt ihesus seiner iungen sagent zu in...“
Deutsch um 1500 (Luther, 1525)
„Da sie nu nahe bey Hierusalem kamen gen Bethphage an den oleberg, sandte Jhesus seyne iunger zween und sprach zu yhn....“
Deutsch um 2000:
„Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Betfage am Ölberg. Jesus schickte zwei Männer voraus...“
Sprachwandel gehört zu lebendigen Sprachen dazu
Ersteres Beispiel hätte sich wohl auch schon für Goethe fremd angehört, für uns ist der Sinn fast schon gar nicht mehr zu entschlüsseln. Sprachwandel ist ein natürlicher Prozess, den es auch in anderen Sprachen gab und gibt, zum Teil mit noch extremeren Ausprägungen wie beispielsweise im Englischen. Die Vergänglichkeit der Sprache als zeitlich abgeschlossener, akustischer Akt ist die Quelle des Sprachwandels. Die kulturpessimistische Attitüde, die dem Sprachwandel heut zu Tage entgegenschlägt, ist kein neues Phänomen. Zunächst wird Sprachwandel von „normalen Sprachteilnehmern“ (Von Polenz, 2009, S. 3) paradoxerweise nicht wahrgenommen. Die Aversion gegenüber neuen Sprachausprägungen liege vor allen Dingen daran, dass zeitgenössische Sprache häufig mit einer von wenigen Gelehrten gesprochenen Hochsprache verglichen wird. Dass sich Goethe und Schiller zur damaligen Zeit auf einem anderen, höheren Sprachniveau bewegt haben als der Großteil der Gesellschaft liegt auf der Hand. Die Hysterie über den angeblichen „Verfall der deutschen Sprache“ blendet diese Bildungsunterschiede meist aus, weshalb es auch in einem Online-Artikel der Süddeutschen Zeitung von 2008 zu diesem Thema heißt: „Genug gebellt“.
Gibt es bald eine Sprache 2.0?
Müsste unser Sprachgenie Goethe sich davor fürchten, auch im Alltag diesem novizischen Sprachwirrwarr begegnen zu müssen? Müssen wir damit rechnen, dass wir uns demnächst auch im Face-to-Face-Kontakt mit internetspezifischen Floskeln begrüßen?
Entwarnung kann Storrer (Storrer zitiert nach dpa, 2009) geben: Außerhalb von Chats tauche die spezielle Sprache kaum auf. Der zweifellos existierende Sprachwandel in Internet-Diensten hat also laut Wissenschaftlern keine negativen Auswirkungen auf die deutsche Sprache .
Das Internet beeinflusst ohne Frage zunehmend die Schreibkultur (Runkehl, Schlobinski & Siever, 2000). In Zeitungen und Fachzeitschriften ist aber laut Storrer kein Wandel zu erkennen. Als Stilmittel in ironischer Sicht allerdings wird die Websprache durchaus genutzt (dpa, 2009).
In einzelnen Bereichen kann laut Runkehl et al. (2000) ein Sprachwandel durch das Internet initiiert oder verbreitet werden. Allerdings glaubt der Großteil der Forscher nicht an einen größeren Sprachwandel aufgrund der Internetsprache. Viele verschiedene sprachliche Elemente aus diversen Diskurswelten fügen sich hier zu einem Stilmix zusammen (s.o.). Diese sogenannte Bricolage erhöht wiederum die sprachliche Variation. Diese Variation ist zwar grundsätzlich die Voraussetzung für einen Sprachwandel, führt jedoch nicht zwangsläufig dazu (ebd.).
Stillstand bedeutet Rückschritt
Entwarnung also, das Kulturgut deutsche Sprach steht nicht vor dem Aus. Neuerungen führen häufig zu Reaktanz, schließlich ist der Mensch ein Gewohnheitstier und hält gerne an Altbewährtem fest. Und die deutsche Sprache hat sich zurückblickend definitiv bewährt. Aber Stillstand würde Rückschritt bedeuten. In besonderem Maße gilt das für die heutige, digitale Zeit im Zeichen der Globalisierung. Ganze Gesellschaften ändern sich in einer noch nie dagewesen Geschwindigkeit und die Antwort darauf heißt Flexibilität. Die Dinge verändern sich und man muss sich anpassen. Wenn deshalb die Sprache im Internet zu rationalen Zwecken verändert wird, dann handelt es sich nur um einen natürlichen Prozess. Schließlich verändert die Sprache sich im Internet, nicht aber durch das Internet. Vielmehr nutzen die User die stilistischen Eigenheiten der Websprache, um die fehlende nonverbale Kommunikation zu ersetzen. Schwarzmalerei und Kulturpessimismus sind also fehl am Platz, denn schon Goethe wusste: „Es hört doch jeder nur, was er versteht.“
Man kann davon ausgehen, dass wir uns erst am Anfang befinden und die „Websprache“ sich noch viel weiter ausprägen wird, um sich den Gegebenheiten anzupassen. Mit Blick auf die Websprachen HTML und CSS scheint dieser Gedanke zumindest nicht abwegig.
1Informell: formlos, zwanglos; in keinem förmlichen Kontext (Duden, 2007)
2Ausnahme: Reine Schriftsprachen wie Latein (vgl. Von Polenz, 2009)
Literatur
- Androutsopoulos, J. K. (2003). Online-Gemeinschaften und Sprachvariation. Soziolinguistische Perspektiven auf Sprache im Internet. Zeitschrift für germanistische Linguistik, 31.2, 173–197.
- Bonfadelli, H., Jarren, O. & Siegert, G. (2005). Einführung in die Publizistikwissenschaft, 2. Aufl., Stuttgart: UTB Verlag.
- Deutscher, G. (2008). Du Jane, ich Goethe: Eine Geschichte der Sprache. München: C.H.Beck Verlag.
- Deutscher, G. (2008). Genug gebellt. Süddeutsche Zeitung. URL: http://www.sueddeutsche.de/kul... (13.12.2009).
- Diekmannshenke, H. (1999). Elektronische Gästebücher. Wiederbelebung und Strukturwandel einer alten Textsorte. Zeitschrift für angewandte Linguistik, 31, 49–75.
- Dürscheid, C. (2005). E-Mail – verändert sie das Schreiben? In J. Runkehl, P. Schlobinski & T.Siever (Hrsg.), Sprache und Kommunikation im Internet, S. 85-97. Berlin: De Gruyter.
- Dpa. (27.05.2009). Netz-Slang. Chat-Sprache wird erforscht. B.Z. http://www.bz-berlin.de/aktuel... (13.12.2009).
- Duden (2007). Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete Aufl., Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag.
- Goethe, J. W. (1856): Goethe‘s sämtliche Werke in sechs Bänden. Amerikanische Stereotyp-Ausgabe. Vierter Band. Philadelphia: J. W. Thomas. URL: http://books.google.de/books?i...
- Goethe, J. W.(1996). Faust: Der Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust. 16. Aufl. München: C. H. Beck.
- Hoffmann, B., Martini, H., Rebel, G., Wickel, H. H., Wilhelm, E., Martini, U. (2004): Gestaltungspädagogik in der Sozialen Arbeit. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag.
- Lischka. K. (2007). Download mal das Proggi zum Foten, das funzt!. In: Spiegel Online. URL: http://www.spiegel.de/netzwelt... (13.12.2009).
- Panke, S. (19.01.2007). Unterwegs im Web 2.0. Charakteristiken und Potenziale. Portalbereich: Didaktisches Design. E-teaching.org (12.12.2009).
- Runkehl, J., Schlobinski, P. & Siever, T. (2000): Sprache und Kommunikation im Internet. Networx. URL:
http://www.mediensprache.net/d... (13.12.2009) - Runkehl, J., Schlobinski, P. &Siever, T. (1998). Sprache und Kommunikation im Internet. Überblick und Analysen. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Siever, T. (2009): Zur Sprache der SMS-Kommunikation. sprache@web. Universität Hannover. URL: http://www.mediensprache.net/d... (13.12.2009).
- Tuor, Nadine (2009). Online-Netzwerke. Eine kommunikationstheoretische, sozialpsychologische und soziolinguistische Analyse. In: Networx. Nr. 55. Rev. 2009-08-25. URL: http://www.mediensprache.net/n... (13.12.2009).
- Unbekannt (1856). Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794 bis 1805. Zweite Ausgabe, erster Band. Stuttgart/Augsburg : J. G. Cotta’scher Verlag.
- Unbekannt (2006). Goethes Briefe an Mitglieder der Berliner Akademie der Wissenschaften. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. URL: http://bibliothek.bbaw.de/goet...
- Von Polenz, P. (2009): Geschichte der deutschen Sprache. 10. Aufl., Berlin: De Gruyter.
- Watzlawick, P., Beavin, Janet H., Jackson, Don D. (2000): Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. 10. Aufl. Göttingen: Hans Huber Verlag.
- Wirth, Uwe (2005). Chatten. Plaudern mit anderen Mitteln. In J. Runkehl, P. Schlobinski & T.Siever (Hrsg.), Sprache und Kommunikation im Internet. Überblick und Analysen. (S. 67-84). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Bildquelle:
http://www.paolofiorani.it/Ava...